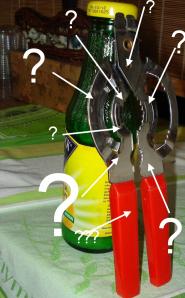|
Achtung unzensiert!
Satiren
Übersicht (Direktlinks):
Känguru im Kopf
Echt der "Burner", des mim Huhschde unn Schnubbe!
Ein intimes Gespräch
Das Ding mit dem Dings
Ungebetene lyrische Gäste
Das Pärchen am Nebentisch
Eimer sind Schweine
Durchgebrannt
Peterpanisch
Das große Fressen
Der Tod des kleinen Kritikasten
Katzenklo und Fischmenü
Antitypen in der Kneipe
Känguru im Kopf
Manche Menschen haben
eigentümliche Berufe. Manchmal sitze ich einfach nur da
und muss plötzlich
denken, dass so ziemlich jedes Ding mit mindestens einem
speziellen Job
verbunden ist, sei es zum Zwecke der Herstellung, der Verteilung,
der Wartung
oder auch der Entsorgung.
Irgendjemand, so geht mir dann durch den Sinn, muss ja zum Beispiel die
Hähncheninnereien
aus den gemeuchelten Kreaturen herauspulen, in Tüten packen
und diese wiederum in die
Hähnchenhintern hineinstopfen. Wie mag wohl die
korrekte Berufsbezeichnung für derlei
Schaffen lauten? Spekulationen
diesbezüglich erscheinen mir geradezu unschicklich.
Und in Anbetracht der Vielzahl äußerst eigentümlicher, menschlicher Berufe und
Berufungen
könnte solch ein Bestreben wohl auch leicht zur Lebensaufgabe
ausarten. Man denke nur an
das täglich millionenfach anwachsende Volk der
Barbiepuppen: Geschickte Hände bewahren
diese anatomisch recht eigenwillig
gestalteten Damen und Herren davor, splitternackt in die
Kinderzimmer dieser
Welt einziehen zu müssen, bekleiden sie mit Miniatur-Stöckelschuhen,
klitzekleinen Dessous und Zwergen-Prêt-à-porter.
Was machst du eigentlich beruflich? Ja, weißt du, man könnte sagen, ich bin
anziehend und
habe ständig mit langbeinigen Puppen zu tun…
Wer friemelt wohl die winzigen Lötnieten an die Speichen der Regenschirme? Und
wie, zum
Teufel, kommt die Führerscheinattrappe nebst Personalausweis und
Kreditkarte von dieser
Frau Mustermann in all die neuen Brieftaschen? Alle Jobs
müssen eben von irgendjemandem
getan werden. Auch das Kläranlagen-Tauchen.
Ist ja im Grunde genommen auch gut so, wenn wir mal von letzterem und ähnlichem
absehen,
nicht wahr, denn wovon sollten wir unseren Kindern die Barbiebande
kaufen, wenn wir nicht
unser Täglich-Huhn mit all diesen ehrbaren
Erwerbstätigkeiten verdienen würden.
(Wenn Barbies Berufe hätten, wären übrigens sicherlich keine der oben genannten
darunter,
denn Blaumann oder Kittel gehören meines Wissens nicht zu ihrer
Standardgarderobe. Das
würde sich beim Ausflug im Miniatur-Cabriolet, auf dem
Reitpferd oder im luxuriösen
Campingwagen auch nicht so gut machen. Da fragt
sich der Fließbandarbeiter während er
der Plastik-High-Society Unterhosen
verpasst, was er wohl herkunftstechnisch falsch
gemacht hat?)
Wenn ich also die vielen Alternativen so bedenke,
finde ich eigentlich, dass ich Glück habe.
Ich habe beruflich nichts mit Hintern
oder Barbieunterhosen zu tun und mit Nieten nur
gelegentlich und im übertragenen
Sinne.
Mal schreibe ich Features, Glossen oder Reportagen für Zeitungen, dann wieder
Kurzgeschichten, Satiren oder Gedichte für Bücher. Romane waren auch schon
dabei.
Das hat lange gedauert, war zermürbend und hatte zuweilen den Spaßfaktor
des
Hähnchenhinternfüllens. Aber bequem hatte ich es dabei, warm ebenfalls, und
solange
ich frische Socken trage, geben auch die Geruchsemissionen keinen Anlass
zur Sorge.
Wenn ich nun so dasitze und das mit den Berufen überdenke, stelle ich mir vor,
wie der
Hähnchen-Auspuler seinerseits dasitzt und über meinen Beruf nachdenkt.
Möglicherweise entschließt er sich, den Meinigen angesichts seiner eigenen
Tätigkeit gar
nicht als ernsthaften Beruf zu akzeptieren. Ich könnte das
durchaus verstehen - gerade
heute Morgen wieder.
Was zum Beispiel soll ein Fließbandarbeiter, der um zehn Uhr morgens schon zum
7583.
Mal den Akkuschrauber angesetzt hat, auch denken, wenn er mich um die Zeit
regungslos
vor einer dampfenden Tasse Kaffee und einem leeren Word-Dokument in
meiner Schreibstube
verharren sieht: "Oh Mann, die schuftet aber heute wieder!"?
Ich würde vermutlich sagen: Ich denke! Und er würde denken: Das faule Stück
träumt!
Womit er genau genommen nicht so ganz unrecht hätte. Und ich auch nicht.
Nur – wie soll
ich einem Menschen, der in meinen Augen allein schon aufgrund
seiner verschmierten
Gummihandschuhe und der Hühnerpampe am Kittel moralisch im
Recht ist, plausibel machen,
dass auch „Arbeit“ nur eine Frage der Definition
ist. Wie, wenn es schon in meinem eigenen
Kopf so profan klingt als würde ich
mich vor lauter schlechtem Gewissen in wirre
Verteidigungsstrategien versteigen?
Ich habe vor einiger
Zeit ein Kinderbuch über einen schlappohrigen Hund geschrieben. Das
hat Spaß
gemacht und war manchmal auch anstrengend. Beides. Spaß und Arbeit zusammen
ist
nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit - behaupte ich. Der Hähnchen-Auspuler legt
die Stirn
in Falten. Ich vermute, dass seine Addition hier zu einem anderen
Ergebnis führt.
Es war fertig, das Kinderbuch. Nur die Einleitung hatte noch gefehlt, und die
Lektorin wurde
allmählich ein wenig hektisch.
Deshalb habe ich eines Tages mal wieder in ehrlicher Vollendungsabsicht im
Schreibzimmer
gesessen, aus dem Fenster geschaut und gelangweilt gewirkt. Der
kleine Fließbandarbeiter
in meinem Über-Ich sagte ab und zu „faules Stück“ - das
war’ s. Keine Eingebungen. Keine
Produktion.
Mein Blick klebte auf dem Garten vor meinem Fenster. Oh, war das leer in meinem
mentalen
„Schreibzentrum“, so still, nur Ruhe, selbstverständlich kreative
Ruhe... bis auf diese
Geräusche in weiter Ferne, die sich tapsend näherten.
Plötzlich sah ich wie es quer über
die Wiese angehopst kam, direkt auf mich zu.
Es stützte den Kopf auf einen Arm und blickte
mich interessiert durchs geöffnete
Fenster an:
„Meinst du mit Ruhe
vielleicht Känguruhe?“, wollte es argwöhnisch wissen und erläuterte
sogleich
kopfschüttelnd: "Das wäre aber völlig inkorrekt, denn mein Plural endet auf „s“,
und außerdem sind wir der Rechtschreibreform zum Opfer gefallen und unseres „hs“
beraubt
worden." Ich erfuhr, dass es ein „Graues Riesenkänguru“, lateinisch Macropus giganteus,
sei und vor dem Autorenberuf nicht die geringste Achtung
habe. Zugegeben, es sei zwar
ganz unterhaltsam, das ganze schriftliche
Analysieren, Kritisieren und Fabulieren, aber ich
solle mir nur nicht einbilden,
einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu
leisten.
Schließlich, so der ungebetene Gast mürrisch, könne man getrost mein komplettes
Geschreibsel der Welt präsentieren, ohne dass sich davon auch nur ein einziger
Magen außer
dem Meinigen füllen würde.
Selbstverständlich konnte ich dies nicht so stehen lassen und setzte zu einem
trotzig-
atemreichen „Aber der Mensch lebt schließlich nicht vom Brot allein!“
an. Durchs offene
Fenster hallte jedoch nur ein polemisches, lang gezogenes „Neiiiin?“
zurück. Ich muss
gestehen, dass es mir nicht gelang, überzeugende Argumente
clever aneinander zu reihen,
da ich auf eine solche Diskussion nicht direkt
vorbereitet war. Allerdings wurde mir alsbald
klar,
dass dieser streitbare Giganteus voll und ganz auf der Seite meines Über-Ich-Bewohners
im
Blaumann
stand.
Wir haben uns dann - nur aus Höflichkeit - noch eine Weile über dieses und jenes
unterhalten,
wobei ich wiederum einräumen muss, dass Kängurus in
umweltpolitischen Fragen und im
Bereich der gesunden Körperertüchtigung weitaus
kompetenter sind als Autoren.
Schließlich verabschiedete es sich mit den Worten: „So, nun hast du ja
hoffentlich was für
deine Einleitung. Jetzt rutsch mir den Buckel runter!“ und
düngte beim Weghopsen noch
ausgiebig mein Tulpenbeet.
Ich habe es dann tatsächlich in meine Kindergeschichte eingebaut, die Diskussion
über meinen
Berufstand und mein armseliges Abschneiden allerdings verschämt
verschwiegen. Die Lektorin
meinte auch, das sei besser so.
Leilah Lilienruh
Wenn Zeitgeistler sich gestresst fühlen,
dann sind sie nicht etwa "einfach total mit
den Nerven am Ende" wie wir
langweiligen Normalos oder fühlen sich "regelrecht
krank von dem ganzen Mist",
sondern sie kriegen solche neudeutschen Krankheiten
wie etwa das "Burnout-Syndrom".
Die haben nämlich nicht nur die chiceren Anzüge und Tussi-Taschis, sondern auch
die
angesagteren Krankheiten. Der stinknormale Südhesse ohne akademischen Grad
und
Edeldesigner-Leibchen bekennt in solchen Fällen freimütig, wenn auch nicht
ganz so eloquent:
“Isch bin joh heit schunn werrer emol escht feddisch!”
Vielleicht kommt dann gerade irgendein
südhessischer Zeitgeistler vorbei und
belehrt ihn streng: “Noa, du bist ned aafach nur
feddisch, moin Liewer. Du
solltest dir dein Kopp vorsischtshalber emol vom Azzt unnersuche
losse, ob du
ned aach des naie, lästische “Börnaud-Sündroom” häwwe tust. Ned, dass du
alsfott
dademit schaffe gehst unn sisch des im Härrn festsetze tut.”
Der arme, eingeschüchterte, stinknormale
Südhesse geht dann möglicherweise wirklich zum
Mediziner seines Vertrauens und
bittet den Fachmann, ob der “vielleischt emol doa neigugge
kennd, dass doa ned
am End erschendebbes kapudd is.” Am liebsten würde er dann natürlich
“aafach e Pill einwerfe unn gud is”. Na ja, so einfach ist das Ganze dann wohl doch nicht,
aber
um den Exkurs hier zu beenden: Autor/inn/en, zumal südhessische, sind
nochmal eine
ganz
spezielle Spezies, die auf Stress sehr eigenwillig reagiert
und zwar meistens nicht mit
englischsprachigen Störungen, sondern mit
Schabernack, gern in Form einer kleinen Satire.
Ich persönlich nehme solche “Anfälle” ja
inzwischen leicht, weil ich mich selbst schon ein
bisschen länger kenne und
davon ausgehe, mich der begründeten Hoffnung hingeben zu
können, dass die
erwartete Ernsthaftigkeit alsbald ins Künstlerhirn zurückschnellt. Familie und
Freunde jedoch haben dem Schalk in meinem Nacken wohl schon einige Querfalten
auf der
Stirn zu verdanken, jene von der Sorte, die entstehen, wenn man die
Augenbrauen öfter mal
halb erstaunt, halb verwirrt hochzieht. Besonders tragisch
ist so ein Satiriker in der Familie
natürlich für die etwaigen Sprösslinge, vor
allem, wenn sie sich gerade im Teenageralter
befinden, wo es quasi als
hormonelle Störung gilt, wenn man sich mal nicht für die eigenen
Eltern schämt.
Ich kann sagen, dass ich diesbezüglich die Hormonausschüttung meiner Kinder
wunderbar ankurbele. Ja, wirklich, Adrenalin bis unter die Schädeldecke. Gerade
gestern
konnte ich meinen Jüngsten, der einige Tage mit einer Erkältung aus der
Schule zuhause
bleiben musste, mit folgender Entschuldigung für seine Lehrer
“erfreuen”. (Nach der Lektüre
meines Textes schien er mir allerdings einige
dieser Querfalten mehr auf der Stirn zu haben.):
Entschuldischung
Arig geehrte Doamn unn Herre,
isch
waas
, dass
des joh
eischentlisch ned
lustisch is, woann
oaner krank is,
äwwer weil
des
Herbstwedder
en sunschd goanz
trübsinnisch macht,
häbb isch mer gedenkt,
isch erkläre
Ehne des emol
uff südhessisch.
Doa klingt doch sogar so en kloane Gripp mit Huhschde
unn
Schnubbe glei
erschendwie witzisch, ned wor?!
Also,
um die Sach korz
zu mache (sou
veel Zeit
häwwe sie joh
sischer aa
ned übrisch als
Pädagog): Der Bub
konnt die Doach aafach
ned oam Unnerrischt
teilnämme, weil er
sou
färschterlisch
huhschde deed, dass mär
denkt hot, dass ehm
glei
des Härrn
rausfliege würd
unn
außerdem dut ehm entsetzlisch der
Kopp schmezze,
woas joh aa beim
Lerne störe kennd
(isch moi, weil mär joh dadezu des Härrn benötiesche dut).
Dem Bub ging’s joh werklisch
hundsmiseroawwel.
Der war joh schunn völlisch nehwer der Kapp, also escht! Außerdem
nevvt des
Gehuschd sischerlisch aa die oannere Kinner unn Kolleje?!
Doa verstäjd
mär joh
faschd ned mer,
woas mer selwer babbeln dut.
Mir is uffgefalle, dass der
Bub alsemol Huhschde hot. Dewäje
häbb isch misch als Mudder
jetzt emol in Ruh hiegesetzt unn
iwwerlegt,
dass‘s
bei Ehne inde Schul vielleischt äjendwu
ziehe dut.
Möglischerweis is doa
joh en Fenschder
undischt orrer
aner vunn de oannere
Kinnern
hot die Gripp
unn bleibt mid
seim Bobbes allweil ned
dehoam. Mär waases joh ned,
gell?! Wenn’s
Ehne einfalle dudd, an woas‘s laie kennd, kennden Sie’s mer joh
vielleischt
emol middeile;-))
Mid fröhlischen
Griese, Ihne Ihr
Leilah Lilienruh
die wo aach schunn als
huhschde dut!
"Warum",
frage ich mich manchmal, "warum passieren solche Sachen ausgerechnet
immer
mir?!" Und warum sehen eigentlich alle schwarzen Motorradjacken aus den
Augenwinkeln gleich aus?
Eigentlich fängt alles meistens ganz harmlos
an. So auch neulich: Gähnende Leere im
Kühlschrank. Ich also mit meinem Schatz
los in den Supermarkt. Butter, Käse, Marmelade,…
da fehlt doch noch was… ahh,
eine passende Unterlage, sonst muss man das Zeug direkt
von der Handfläche
lecken. Wir rüber in die Abteilung mit den Backwaren, und während ich so
guckend
vor den leckeren Fabrik-Broten, überaus gesunden Weißmehl-Brötchen und Kuchen
mit feinstem künstlichem Aroma stehe, fällt mir ein, dass ich am folgenden
Morgen gern mal
wieder Croissants essen würde. NATÜRLICH frische Croissants,
aber dann müsste ja einer
von uns vorher Bett und Haus verlassen und zum Bäcker
latschen. Vielleicht würde es dann
gerade regnen oder stürmen. Womöglich fielen
sogar faustgroße Hagelkörner. Und die Chance
dafür, dass es sich bei dem
bedauernswerten Geschöpf in den gnadenlosen Fängen der Natur
um meine Person
handeln könnte, steht immerhin bei 50 Prozent (selbst mit meinem
lieblichsten Augenaufschlag, der früh morgens und ungeschminkt leider nur halb so
eindrucksvoll rüberkommt).
Lecker, Küchenschwamm!
Also die zum Aufbacken. Schmecken nicht wie echte Croissants, sehen nicht aus
wie echte
Croissants und sind in der Konsistenz einem Küchenschwamm nicht
unähnlich, haben nur mehr
Kalorien. Nun gut, wenn die äußeren Umstände
entsprechend sind, beißt man hin und wieder
auch mal in einen Küchenschwamm.
Ich suche also das entsprechende Regal mit den
Augen nach der begehrten Ware ab und
säusele dabei meinem Schatz, der mit dem
Wagen schräg hinter mir steht, zu, dass wir es
uns nach dem Frühstück im Bett ja
noch ein bisschen eben dort gemütlich machen könnten,
er wisse schon, wie ich
das meine.
Er ist kein Freund von vielen Worten. So wundere ich mich also auch nicht
darüber, dass
er einfach nur schweigend dasteht und wartet. Ich bin dermaßen mit
meinen Croissants und
der netten Szene in meinem Kopfkino beschäftigt, dass ich
ihn gerade nicht anschauen kann,
aber ich sehe ja aus den Augenwinkeln seine
Lederjacke.
Er dürfe auch die Croissantkrümeln aus meinem
Bauchnabel pusten, verspreche ich ihm noch,
und es folgt eine kurze Aufzählung
der Dinge, die außerdem denkbar wären. Selbstverständlich
wähle ich dabei eine
tiefere Stimmlage und jenen Unterton, den ich persönlich für erotisch
halte. Ich
finde, jetzt könnte er ruhig mal was dazu sagen. Wenigstens ein zufriedenes
Brummen wäre doch wohl angebracht, wenn frau sich verbal derart ins Zeug legt.
Hah, ich hab’s! Triumphierend schwenke ich die Tüte zu ihm herum: „Die haben die
krümeligen,
kleinen Scheißerchen aber prima vor mir versteckt!“, entschlüpft es
mir noch als ich das
Päckchen gerade in den Einkaufswagen werfen will.
Im falschen Film?
Zwei Sixpacks Bier, Partytüte Kartoffelchips, Tiefkühlpizza… ? Das ist aber
nicht unser
Einkaufswagen – logischerweise, das ist nämlich auch nicht mein
Mann! Der alte Ignorant ist
längst weitergeschlendert zum nächsten Regal und hat
gar nichts von meinen heißen
Versprechungen mitgekriegt. Der junge Mann in der
schwarzen Lederjacke schräg hinter mir
dafür aber schon. Der schaut mich jetzt
irgendwie ziemlich verwundert an und rührt sich nicht
von der Stelle… Auf was
wartet der? Und hat ihm schon mal jemand gesagt, dass es relativ
unvorteilhaft
aussieht, wenn man mit offenem Mund glotzt?
Während ich murmele: „Vergessen Sie’s einfach,
okay?!“, um mich eiligst in Richtung des
eigenen Einkaufswagens nebst
Liebesobjektes zu begeben, hoffe ich noch inständig, dass
sein Kopfkino im
Gegensatz zu meinem einen jugendfreien Film gezeigt hat und dass wir uns
nie
wieder begegnen.
Es gibt diese Augenblicke, wo ich mir wünsche,
auf einer Falltür zu stehen und die
Fernbedienung in der Hand zu halten. Mein
Schatz hat sich übrigens vor Lachen gebogen,
bevor ihm eingefallen ist, mit
theatralischer Senkrechtfalte auf der Stirn nachzuschieben:
„Super, kaum dreht
man sich mal kurz um, schon quatschst Du wildfremde Typen an!“
Ein bisschen Mitleid hätte schon sein dürfen,
oder?
Leilah Lilienruh
Also, dass mir aus schier unerfindlichen
Gründen hin und
wieder die eine oder andere peinliche Panne passiert,
habe ich
ja bereits anhand einiger Fallbeispiele veran-
schaulicht. Sei es das
versehentliche Händchen-halten
mit wildfremden Herren oder das Verschwinden im
Wandschrank des Bürgermeisteramtes – wenn irgendwo
ein Fettnäpfchen wartet, dann
finde ich es schon.
Da gäbe es dann allerdings noch so eine kleine Macke, die
mir als Autorin ja nun
ganz besonders unangenehm und
zudem noch arbeitserschwerend ist.„Meyers Lexikon“ nennt das Phänomen
höflicherweise nicht
Macke, sondern ganz elegant „Wortfindungsstörung“ und führt
aus: „Symptom der amnestischen Aphasie, wobei der gesuchte
Begriff nicht
gefunden und deshalb durch andere umschrieben
wird.“ Ich sage es einfach mal in
meinen Worten: Mein Problem
ist das Ding mit dem Dings!
Man stelle sich beispielsweise eine ganz banale
Alltagssituation vor: Ich decke den
Frühstückstisch und kriege – wie gewöhnlich
– den Deckel vom neuen Marmeladenglas nicht
auf. Was suche ich nun also
angestrengt in meiner Küchenschublade (nein, nicht die helfenden
Hände eines
starken Mannes): Das Dings! Na, das Dings, Ihr wisst schon, das längliche aus
Metall mit Plastikgriffen, vorn innen so abgerundet, mit Zacken dran, damit man
nicht
abrutscht, das, womit ich auch immer die Konservengläser aufmache. Ach
Mensch, wie
nennt man das noch gleich…?
Man stelle sich weiter vor: Mein großer Sohn
betritt in diesem Moment die Küche. Ich
beschreibe ihm derart umständlich das
Objekt meiner Suche und verfalle bei meinem
„Bilderrätsel“ in immer neue
ausschweifende Erklärungen: „Du weißt schon, Schatz, das Dings,
das der Papa
damals im Restpostenladen gekauft hatte, was dann aber gleich kaputt
gegangen ist und was ich dann später nochmal neu vom Kaufhaus in der Fußgängerzone…“.
Und was tut mein Sohn? Schnappt sich das Marmeladenglas, dreht einmal locker am
Deckel,
plopp, drückt mir das Glas wieder in die Hand und grinst: „Deckelöffner,
Mama, einfach
Deckelöffner! Aber den brauchste ja jetzt nicht mehr.“
Ähm, dankeschön!
Wie die meisten anderen Fallen im Leben tritt
übrigens auch die Wortfindungsstörung gern im
Rudel auf. Hat man erst einmal so
ein Blackout, dann scheint sich die verbale Verblödung
augenblicklich im Gehirn
auszubreiten. In solchen Momenten kommt es dann vor, dass ich das
eine Dings mit
einem anderen Dings zu erkären versuche, was besonders intelligent wirkt.
„Dingse“ müssen übrigens nicht immer Dinge
sein, sondern können auch für Personen
eingesetzt werden. Hier ein Beispiel aus
der Welt des Films: Heimischer Videoabend. Alles
konzentriert sich gebannt auf
die Einleitungssequenz des Spielfilms, den mein Mann
ausgeliehen hat. Da
erscheint plötzlich dieser überaus gutaussehende, charmante
Schauspieler auf der
Bildfläche, dieser Dings, Ihr wisst schon der, der auch in dem einen
Film
mitgemacht hat, der Streifen damals hieß… Dings, ach Mensch, na, gleich komme
ich
drauf,
„Kate und Dings“… Na, jedenfalls hat der da mit der „Meg Dings“
zusammen gespielt,
damals…
Und dann auch noch in “Australia” mit der anderen
dünnen, blonden Dings… hier,
sagt doch
mal, die Ex von dem Tom Dings. Und vor
einigen Jahren wurde der doch auch zum
„Sexiest
Man Alive“ gewählt. Irgendwas
mit „Jack“ war’s. Nee, wartet mal, im Nachnamen
war der
„Jack“, ach, genau,
logisch „Jackman“. Aber, wie zum Geier, heißt denn der jetzt noch
gleich
mit
Vornamen? Das gibt’ s doch gar nicht… gleich hab’ ich’s… Dings… Dings… Dings…
Wenn meine Familie ganz viel Glück hat, finden
diese Überlegungen nur inwändig statt, so
dass ich allein den ganzen Anfang vom
Streifen nicht richtig mitkriege. Ansonsten kommt es
schon mal vor, dass mir ein
vierstimmiges: „Hugh! Und jetzt Ruh!“ entgegenschallt.
Na gut, für heute erst einmal genug von meiner
Wortfindungsstörung. Ich hoffe, Ihr habt
nicht das gleiche Problem, denn das ist
wirklich sehr störend bei der… Dings… na, Dings…ähm…
KommuDings, ach, Ihr wisst
schon!
Leilah Lilienruh
|
|
Onlinebestellung
Nutzen Sie unser intuitives
Bestellformular.
...mehr
Zahlungsweise
Haben Sie Fragen zu den
Zahlungsmethoden?
...mehr

Nachwuchsförderung
"Wortquelle" freut sich
über Bewerbungen junger
Hörspielsprecher/innen.
...mehr
|